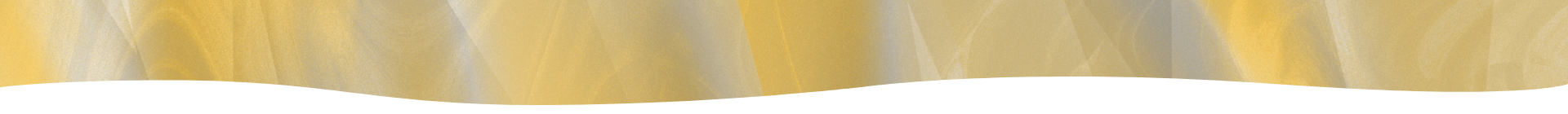Youth Citizen Social Science
16.07.2024 – Sara Plassnig berichtet uns von ihrer Forschungsarbeit mit Jugendlichen zu sozialer Inklusion und teilt ihre Expertise darüber, wie inklusive Forschung mit Menschen gelingen kann, die von sozialer Exklusion bedroht sind.
Hallo Sara, kannst Du Dich kurz vorstellen?

Hallo, ich bin Sara Plassnig und ich arbeite zurzeit in der Abteilung für Internationale Umwelt und Entwicklung am Norwegischen Institut für Wasserforschung (NIVA) in Oslo. Bei NIVA bin ich hauptsächlich in internationalen Projekten zum Thema Plastikverschmutzung tätig. Ich forsche über den informellen Recyclingsektor in der ASEAN Region und Indien und darüber, inwiefern jene Menschen in den UN-Verhandlungen zu einem internationalen Plastikabkommen inkludiert werden. Menschen, die im informellen Abfallsektor arbeiten, sammeln Plastikmüll ein und verkaufen recyclebare Produkte zur Wiederverwertung. Dabei erleben sie häufig Ausnutzung, Diskriminierung, und Sexismus. Des Weiteren beschäftige ich mich mit Capacity Development – wie man in ASEAN Ländern mit wenigen Ressourcen auf eine inkludierende und nachhaltige Art und Weise dazu beiträgt, Plastikverschmutzung zu verringern. Davor habe ich für die Universität OsloMet gearbeitet, wo ich unter anderem im YouCount Projekt mit dabei war. Das YouCount Projekt ist ein Horizon 2020 Projekt bei dem es um Youth Citizen Social Science geht. Das Projekt hat von 2021 bis Ende 2023 stattgefunden.Themen, mit denen ich arbeite, haben eines gemeinsam, und zwar, dass Entscheidungen, die von einer Minderheit getroffen werden, oft die größten Auswirkungen auf jene Menschen haben, die nie um ihre Meinung gefragt wurden – das muss sich ändern!
Kannst Du beschreiben, inwiefern das Projekt „YouCount“ einen Bezug zu Inklusion hat?
In dem Projekt YouCount ist es hauptsächlich darum gegangen, gemeinsam mit Jugendlichen über die soziale Inklusion von Jugendlichen zu forschen. Wir hatten co-researchers - Mitforscher oder citizen scientists - mit denen wir gemeinsam die Interviewfragebögen ausgewertet haben, die Interviews geführt haben, mit anderen Living Labs veranstaltet haben, und Daten ausgewertet haben. Wir hatten zehn „Fälle“, in neun Ländern in Europa und in jedem Fall, haben wir einen anderen Fokus gehabt. Wir haben also mit sehr vielen unterschiedlichen Jugendlichen zusammengearbeitet, die alle gemeinsam hatten, dass sie ein Risiko zur sozialen Exklusion erlebt haben, also von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Das ist heutzutage ein großes Problem in Europa, dass immer mehr Jugendliche sich nicht zugehörig fühlen, also das Zugehörigkeitsgefühl verloren geht. Dass sie nicht das Gefühl bekommen, dass sie teilhaben können, dass sie mitbestimmen können.
Wie habt ihr Machtverhältnisse, die dazu führen, dass sich bestimmte junge marginalisierte Gruppen nicht zugehörig fühlen, im Laufe des Projekts reflektiert? Habt ihr es geschafft diese zu durchbrechen?
„Wichtig ist zu fragen was die Jugendlichen wollen und nicht einfach anzunehmen - Okay, wir bestellen Pizza“

Wichtig war, eine „Schlüssel-Figur“ oder einen „Gatekeeper“ von einer Community zu finden, mit der man dann gemeinsam Jugendliche erreicht, um mit denen zu arbeiten. Bzgl. Machtverhältnisse haben wir versucht im Vorhinein darüber zu reflektieren, wie wir die Jugendlichen treffen. Im Oslo-Case hatten wir zum Beispiel ein Wochenende mit einem intensiven Workshop zum Thema Recherche, indem wir gemeinsam verschiedene Recherche-Methoden ausprobiert haben. Dadurch haben wir Vertrauen geschafft und uns kennengelernt. Wenn man mit Gruppen arbeitet, von denen man weiß, dass eine gewisse Hierarchie besteht, ist es sehr wichtig die eigene Position zu reflektieren, viel Zeit für Pausen einzulegen und „Round Tables“ zu haben - also einen runden Tisch, wo jeder zu Wort kommen kann. Wichtig ist, das Ganze spielerisch und kreativ anzugehen. Gemeinsames Essen war auch sehr wichtig, einfach weil es so eine Barriere nieder bricht. Dazu fragen, was die Jugendlichen wollen! Also nicht einfach anzunehmen - Okay, wir bestellen Pizza, sondern zu fragen - Worauf habt ihr Lust? „Debriefs“ nach den Workshops und Treffen sind auch wichtig, damit man gemeinsam im Recherche-Team über gewisse Situationen reflektiert, wo man gemerkt hat – Okay, hier fühlen sich die Teilnehmer*innen nicht so sicher. Wir haben zum Beispiel diskutiert, was es mit der Dynamik in Gesprächen macht, wenn alle Erwachsenen stehen und die jungen Menschen sitzen oder wenn man Notizen schreibt.
Wie habt ihr den Kontakt zu den „Gatekeepern“ hergestellt? Welche Personen waren das?
„Ich glaube, es ist sehr wichtig in solchen Projekten, dass man irgendwie einen Eingang findet über Menschen, die bereits Vertrauen haben zu Gruppen, die gewisse Herausforderungen haben. Und nicht dann als Forscher/Forscherin einfach so mal irgendwo hereinplatzt und mal fragt, wer denn so mit dabei ist bei einem Forschungsprojekt.“
In dem Oslo-Fall haben wir Kontakt zu einer Nachbarschaftsorganisation aufgenommen, die sehr viel mit Jugendlichen in dem Stadtteil arbeiten, in dem wir unseren Fall hatten. Dieser Stadtteil zeichnet sich dadurch aus, dass dort sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund dort leben, vergleichsweise einen relativ niedrigen Lohn haben und dass sehr viele Jugendliche nicht wissen, wie sie einen Job bekommen. Das Thema in Oslo war, wie man dazu beiträgt, dass Jugendliche einen Job finden, wo sie sich entfalten können. Eben nicht nur irgendeinen 0815 Job, wo man ausgenutzt wird, sondern einen Job, der einen in Zukunft weiterbringt. Die Nachbarschaftsorganisation mit der wir Kontakt aufgenommen haben, hat unter anderem eine Kollegin, die selbst Teil von der Community ist. Sie ist relativ jung, trägt Hijab engagiert sich sehr für andere junge Menschen. Sie war sozusagen die Kontaktperson, über die wir an andere Jugendliche gekommen sind. Ich glaube, es ist sehr wichtig in solchen Projekten, dass man irgendwie einen Eingang findet über Menschen, die bereits Vertrauen haben zu Gruppen, die gewisse Herausforderungen haben. Und nicht dann als Forscher/Forscherin einfach so mal irgendwo hereinplatzt und mal fragt, wer denn so mit dabei ist bei einem Forschungsprojekt. Ich glaube, da hat man nicht so viel Erfolg. Man muss sich auch immer die Frage stellen, was die Teilnehmenden im Endeffekt davon haben teilzunehmen und das auch kommunizieren.
Würdest du sagen, es ist euch gelungen, das Vertrauen zu den Jugendlichen weiter aufzubauen?
„Man braucht sehr viel Zeit und Flexibilität, um Vertrauen aufzubauen und das auch aufrechtzuerhalten.“
Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch erwähnen, dass auch sehr viele Ressourcen dafür verwendet worden sind und wir sehr viele Abende und Wochenenden mit Jugendlichen verbracht haben. Also entweder man muss ein Projekt finanziert bekommen, wo man eben so viel Flexibilität hat oder man muss irgendwie Geld auf eine andere Art und Weise beschaffen. Durch andere Projekte vielleicht, oder man muss teilweise halt freiwillig arbeiten, um das hinzukriegen. Also man braucht sehr viel Zeit und Flexibilität, um Vertrauen aufzubauen und das auch aufrechtzuerhalten. Wir haben teilweise jede Woche Workshops mit den Jugendlichen gehabt. Mittwochabends war das oft und wir haben dann immer auch Essen mitgebracht, weil die Jugendlichen direkt von der Schule gekommen sind und wir von der Arbeit. Und auch immer anzupassen, was man macht, je nachdem wie viel Motivation und Energie gerade da ist. Zum Beispiel in der Periode, wo viele Prüfungen sind, kann man dann nicht voll intensive Interviews führen. Also es waren hauptsächlich die Jugendlichen, die Interviews geführt haben. Und wir haben sie da unterstützt.
Welche digitalen und nicht-digitalen Methoden haben sich im Projekt YouCount als besonders geeignet erwiesen? Welche Erfahrungen habt ihr mit der „YouCount-App“ gemacht?
„Ich glaube es ist wichtig […], dass man eben nicht so schnelle Schlüsse schließt, nur weil man mit jungen Menschen arbeitet. Dass man sofort denkt – ja okay, alles muss digital sein. Eine Mischung tut hier gut.“
Wir haben zum Beispiel Webinare veranstaltet. In den Webinaren haben wir versucht, Werkzeuge wie „Miroboards“ und „Jamboards“ zu verwenden, um das Ganze interaktiver zu gestalten. Wir haben erlebt, dass beim ersten Webinar, bei dem Jugendliche sich weder gegenseitig, noch Forschende von anderen Ländern gekannt haben, wenig Teilnahme da war. In solchen Formaten ist es wichtig, dass man das Vertrauen aufgebaut hat und dass Jugendliche wirklich fühlen – okay, sie sind Teil von etwas, Teil von etwas Größerem, einem internationalen Projekt. Alle Fälle haben mit der YouCount App gearbeitet. Mit der App haben wir einige Schwierigkeiten erlebt, vor allem mit der GDPR und bürokratischem Aufwand. Vor allem dadurch, dass wir mit jungen Menschen arbeiten und Daten einsammeln. Bei vielen Citizen Science Projekten geht es ja darum, dass man die Natur beobachtet und aufzeichnet. Wir hatten aber ein Citizen Social Science Projekt, wo es eben darum geht, dass man zum Beispiel Gefühle aufzeichnet und mit Menschen über Menschen forscht. Dinge wie soziale Inklusion sind kritischer und man muss mehr bezüglich GDPR und Datenschutz aufpassen. Einige Schwierigkeiten haben auch zu Verzögerungen geführt. Dadurch haben einige Jugendliche die Motivation verloren, die App auszuprobieren. Über die App haben wir aber auch sehr viel zum Thema Datenschutz mit den Jugendlichen lernen können.
Eine nicht-digitale Methode, die Forscher*innen von OsloMet entwickelt haben, ist „Splot“. In der Splot-Methode geht es darum, dass man gemeinsam eine Form zeichnet - also eben keinen Kreis, sondern eine Lache, eine Pfütze. Darin platziert man dann Dinge, die einem wichtig sind. Das ist eine kreative, partizipative Methode, wo man gemeinsam über etwas redet, was einem wichtig ist, ohne dass man direkte Fragen gestellt bekommt. So sind wir an Themen, wie zum Beispiel soziale Inklusion, rangegangen - wo fühlst du dich sozial inkludiert, wo fühlst du dich sozial geborgen. Das platziert man dann in dem Splot. Das macht man zuerst individuell und dann in der Gruppe. Was noch gut funktioniert hat, waren große analoge Karten, wo man eine Nachbarschaft skizziert. Man identifiziert zum Beispiel Plätze, wo man gerne Zeit verbringt und auch warum und darüber dann diskutiert. Wir haben teilweise erlebt, dass Jugendliche eine digitale Müdigkeit haben, weil sie dauernd auf sozialen Medien sind und mit digitalen Inhalten und Werkzeugen konfrontiert werden. Wie haben erlebt, dass es ganz gut funktioniert hat, einfach nur ein Blatt Papier und einen Stift anstatt digitale Formate zu verwenden. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man die Menschen, mit denen man gemeinsam arbeitet und forscht, fragt, welche Formate ihnen passen - und wann und inwiefern. Dass man eben nicht so schnelle Schlüsse schließt, nur weil man mit jungen Menschen arbeitet. Dass man sofort denkt – ja okay, alles muss digital sein. Eine Mischung tut hier gut.
Sara, kannst Du beschreiben, was ihr unter dem Ansatz der „co-creation“ versteht und berichten, inwiefern es euch gelungen ist, diesen Anspruch in die Realität umzusetzen?
„Das Thema co-creative […] braucht eine gewisse Einstellung, dass man selbst Macht und Entscheidungen abgibt.“
Das Thema „co-creative“ braucht, wie schon vorhin genannt, viel Zeit und Flexibilität. Und auch eine gewisse Einstellung, dass man selbst Macht und Entscheidungen abgibt. Und dass man die, die Entscheidungen treffen sollen - also in unserem Fall waren das eben Jugendliche - unterstützt diese Entscheidungen treffen zu können. Also Trainings zu geben, Werkzeuge zu geben, gemeinsam Ansätze zu diskutieren.
YouCount war in dem Sinne co-creative, weil Jugendliche selbst Recherchefragen und Interviewguides entworfen haben, Interviews geführt haben und entschieden haben, wie sie die Daten dann präsentieren. Im Oslo Case war es eine interaktive Ausstellung, die wir in einem Museum veranstaltet haben. Was das Ganze vielleicht erschwert, ist, dass man bei Projekten ja oft sehr viel im Vorhinein bestimmen muss, bevor die Menschen, mit denen man in der Forschung arbeiten will, einbezogen werden. Es ist schwer in dem Prozess bereits alle Menschen, die später involviert werden sollen, bereits miteinzubeziehen. Das macht es dann teilweise schwer, weil man Sachen verspricht, in so einem Proposal, die man dann irgendwie verändern muss. Es war zum Beispiel sehr schwierig Gelder aufzutreiben, um Jugendlichen zu ermöglichen, dass sie sich treffen können. Wir hatten, wie bei vielen Horizon Projekten, Konsortium-Meetings. Und bei einem Konsortium Meeting waren Jugendliche von verschiedenen Ländern dabei. Da mussten wir schauen, wie wir das Finanzieren - die Flüge, Hotels und die Aktivitäten, die die Jugendlichen dort machen. Wir hatten auch eine Abschlusskonferenz, wo auch wieder sehr viele Jugendliche von verschiedenen Ländern teilgenommen haben. Da mussten wir dann wieder herausfinden – Okay, wie gestalten wir das so, dass es spannend wird für die Jugendlichen, dass sie dort zu Wort kommen, dass sie sich wohlfühlen usw.
Was können Reallabore von dem Projekt YouCount lernen?
„Formate finden, wo man gemeinsam aktiv etwas erforscht und nicht nur am Tisch sitzt und Dinge diskutiert.“
Also bei den Reallaboren, die wir veranstaltet haben, war es sehr wichtig, dass wir Formate finden, die wie Ice-Breaker funktionieren. Wobei sich alle Teilnehmenden wohlfühlen und eine Sicherheit erleben, dass sie offen Dinge ansprechen können. Bei unseren Living Labs waren zum Beispiel Lokalpolitiker dabei, Menschen von verschiedenen NGOs, von Sportclubs, Kulturclubs usw. und eben Jugendliche. Also viele Erwachsene und ein paar Jugendliche und da mussten wir Formate finden, wo man gemeinsam aktiv etwas erforscht und nicht nur am Tisch sitzt und Dinge diskutiert. Also kreative Methoden sind sehr wichtig und einen Rahmen zu gestalten, wo sich jeder wohlfühlt. Und natürlich diejenigen, die teilnehmen, zu fragen: Was wollt ihr machen, was wollt ihr diskutieren?
Wie können Reallabore einen sicheren Raum schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und zu Wort kommen können?
„Wir haben mit den Jugendlichen im Vorhinein auch darüber geredet, was sie präsentieren, zu welchen Themen sie sich wohlfühlen frei zu sprechen und haben sie dann ermutigt, in den Situationen etwas beizutragen.“
Es ist wichtig darauf zu achten, wie die Dinge im Raum angeordnet sind, wo Menschen sitzen, Gruppen zu mischen und Aktivitäten zu gestalten. Wenn man zum Beispiel viel Fragen stellt, dass man die Antwortmöglichkeiten aktiv gestaltet – zum Beispiel, indem man sagt, die, die Antwort a wählen, gehen in diese Ecke und die, die Antwort b wählen, in die andere. Oder Karten zu haben, wo man gemeinsam Dinge in der Nachbarschaft erforscht - also embodied Research. Wir haben mit den Jugendlichen im Vorhinein auch darüber geredet, was sie präsentieren und zu welchen Themen sie sich wohlfühlen frei zu sprechen. Wir haben sie ermutigt etwas beizutragen. Namensschilder sind quasi Basics, aber sind auch sehr wichtig. Man hat dann mehr Selbstbewusstsein jemanden anzusprechen, weil man oft Namen vergisst und das kann ein Hindernis sein.
Wie geht ihr mit Situationen um, in denen die Dynamik im Raum ins Ungleichgewicht gerät? Wie können Forscher*innen hier unterstützend wirken?
„Es ist wichtig, die Kommunikation zu den Jugendlichen zu halten, damit man weiß - was wird von einem erwartet, was ist erwünscht in welchen Situationen.“
Ich kann mich relativ gut an eine Situation in einem Living Lab erinnern, wo ein erwachsener Teilnehmer einem Jugendlichen sehr viele Fragen gestellt hat. Also es hat so gewirkt, als ob die Person die Expertise von dem Jugendlichen ausnutzt. Es hat so gewirkt, als ob die Person nie mit Jugendlichen in Kontakt kommt, obwohl sie eigentlich zu dem Thema arbeitet. Die Person hat dann sehr viele Fragen für die eigene Arbeit gestellt. Da hat sich dann jemand von uns dazugestellt und versucht das Gespräch zu beenden. Es ist wichtig, die Kommunikation zu den Jugendlichen zu halten, damit man weiß was von einem erwartet wird und was in welchen Situationen erwünscht ist. Zum Beispiel hatten wir einmal eine Situation, in der Jugendliche in einem Jugendclub Interviews führen sollten. Bei den Interviews, die Jugendliche davor mit Erwachsenen geführt haben, waren wir im Hintergrund immer mit dabei. Wir hatten das Gefühl, dass ihnen das sehr Recht war, einfach so als Backup, wenn ihnen eine Frage nicht einfällt, oder wenn das Gespräch in eine unangenehme Richtung geht. Im Jugendclub war es dann aber ganz anders. Da war ihnen das dann ganz unangenehm, dass wir da mit hineingehen sollten. Sie wollten die Interviews dann allein führen. Es ist halt sehr situationsabhängig, wie man welche Art von Unterstützung haben will und da muss man sensibel sein und auch eine offene Kommunikation schaffen.