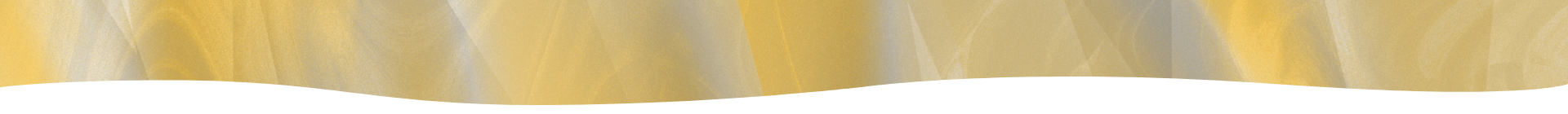Wie Inklusion im KARUNA Reallabor gelingt: Ein Gespräch mit Rebecka Ambjörnsson
23.01.2025 – Das KARUNA Reallabor: Plattform für Teilhabe und Innovation

Der Ursprung der KARUNA Sozialgenossenschaft liegt in den Strukturen des Vereins Karuna e.V., einer Hilfsorganisation, die sich seit 1989 für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen einsetzt. Aus dem Verein entstand im Jahr 2016 die KARUNA Sozialgenossenschaft mit dem Ziel, möglichst diverse Gruppen in demokratische Prozesse einzubinden. Ein gutes Beispiel dafür ist das KARUNA Reallabor, wo konkrete Herausforderungen und Fragestellungen im Mittelpunkt stehen, die von jungen Menschen, Partnerorganisationen oder den Mitarbeitenden selbst eingebracht werden. Rebecka betont den praxisorientierten Ansatz der Reallabor-Arbeit:
„Es geht darum, Probleme zu formulieren, Ideen zu entwickeln und dann direkt auszuprobieren, statt nur theoretisch zu bleiben.“
Rebecka berichtet aus ihrer Reallabor-Praxis, welche Ansätze und Maßnahmen für eine gelungene Einbindung von Menschen mit Ausgrenzungserfahrungen wichtig sind.
Flexible Ansätze für Beteiligung
Eine der größten Herausforderungen des KARUNA Reallabors bestand darin, die Kluft zwischen akademischen Institutionen und den Lebensrealitäten der Zielgruppen zu überbrücken. Ursprünglich sollte die Zusammenarbeit mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde im Zentrum stehen. Doch dieser Ansatz wird jetzt angepasst:
„Für Menschen, die auf der Straße gelebt haben, Drogenprobleme hatten oder keinen Schulabschluss besitzen, gibt es viele Hürden, einfach in eine Hochschule zu gehen.“
Stattdessen setzt KARUNA nun auf einen praxisorientierten Ansatz, bei dem die Ideen und Fragestellungen direkt von betroffenen Menschen kommen. Wissenschaftliche Institutionen werden im nächsten Schritt eingebunden. Zudem geht KARUNA flexibel auf die Bedürfnisse und Kapazitäten der Zielgruppe ein:
„Manchmal ist es nur ein Abend, an dem sie zusammen Ideen entwerfen, wie bei einem Utopieworkshop. Manchmal ist es ein Jahr, wie beim Freiwilligen Aktivistischen Jahr, bei dem junge Menschen für ihre Arbeit bezahlt werden.“
Das Freiwillige Aktivistische Jahr, das KARUNA anbietet, ist ein Format, das nicht nur aktive Beteiligung ermöglicht, sondern auch finanzielle Hürden überwindet. Junge Menschen können sich für Klimaschutzmaßnahmen in Berlin engagieren und bringen ihre Perspektiven in Projekte ein, die sie selbst betreffen.
Das Beteiligungscafé am Boxi: Ein Raum für Dialog und Begegnung
Ein Paradebeispiel für KARUNAs Arbeit ist das Beteiligungscafé am Boxhagener Platz in Berlin – kurz „Boxi“. Ursprünglich ein klassisches Café, hat es sich in ein Beteiligungsbüro verwandelt. Rebecka beschreibt die Idee dahinter:
„Wenn wir einen Tag am Boxi sitzen, laufen hunderte von Menschen vorbei, kommen rein und fragen, ob sie einen Kaffee haben dürfen. So entstehen ganz natürliche Gespräche.“
Das Café ist ein lebendiger Treffpunkt, an dem unterschiedlichste Menschen zusammenkommen. Dieser Ort ermöglicht es Menschen, Selbstwirksamkeit zu erfahren – eine zentrale Idee hinter KARUNAs Arbeit:
„Wenn Menschen das Gefühl haben, dass wir ihnen vertrauen und sie nicht als hilflose Klient:innen behandeln, dann wollen sie auch mehr machen. Wir alle wachsen daran.“
Erfolgsgeschichte: Die Mokli-App
Eine weitere beeindruckende Erfolgsgeschichte des KARUNA Reallabors ist die Entwicklung der Mokli-App. Diese App entstand auf Initiativejunger Menschen, die zeitweise auf der Straße lebten und feststellten, wie schwierig es ist, Hilfsangebote zu finden.
„Gemeinsam mit Google und anderen jungen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, entstand die Mokli-App.“
Die App bündelt Informationen zu Hilfsangeboten und wird nicht nur von Einzelpersonen genutzt, sondern auch von Organisationen empfohlen, die sie in ihre Arbeit integrieren. Das Projekt wurde durch den Google Impact Award finanziert und zeigt, wie technologische Lösungen konkret helfen können.
Herausforderungen in der Arbeit mit marginalisierten Gruppen
Trotz vieler Erfolge sieht sich KARUNA immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert. Besonders wichtig ist die Frage nach fairer Entlohnung und nachhaltiger Beteiligung:
„Studierende bekommen für ihre Arbeit Credits – aber was bekommen die anderen, die genauso aktiv mitarbeiten?“
Die Arbeit mit marginalisierten Gruppen erfordert zudem Sensibilität und die Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen. Rebecka betont:
„Organisationen sollten zuerst nach innen schauen: Wie divers sind wir selbst? Welche Barrieren existieren in unseren eigenen Strukturen?“
Statt marginalisierte Gruppen isoliert anzusprechen, setzt KARUNA auf die Zusammenarbeit mit bestehenden Organisationen, die bereits Zugang zu diesen Gruppen haben.
Empfehlungen für inklusivere Reallabore
Zum Abschluss teilt Rebecka wertvolle Empfehlungen für andere Reallabore, die ihre Projekte inklusiver gestalten möchten:
1. Diversität als Bereicherung erkennen:
Menschen mit anderen Perspektiven bringen wertvolle Expertise mit, die durch ihre Lebenserfahrung geprägt ist. Diese Expertise ist unverzichtbar, wenn es darum geht, Probleme zu verstehen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln.
„Wenn man ein Problem lösen will, muss man die Menschen kennen, die das Problem erlebt haben. Sie sind die wahren Expert:innen.“
2. Selbstreflexion:
Organisationen sollten ihre Strukturen und Prozesse hinterfragen, bevor sie Diversität nach außen fördern:
„Der erste Schritt ist, intern zu schauen, wie divers wir sind, bevor wir uns extern an andere Gruppen wenden.“
3. Zusammenarbeit und Selbstwirksamkeit fördern:
Statt isolierte Ansätze zu verfolgen, sollten Ressourcen und Wissen mit bestehenden Organisationen geteilt werden. Diese Zusammenarbeit sollte auf Selbstwirksamkeit der Beteiligten ausgerichtet sein - die Erfahrung, durch eigenes Handeln etwas bewirken zu können:
„Wenn Menschen das Gefühl haben, dass wir ihnen vertrauen und sie nicht als hilflose Klient:innen behandeln, dann wollen sie auch mehr machen. Sie wachsen daran.“
Das Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein und sinnvolle Beiträge leisten zu können, stärkt nicht nur das Selbstbewusstsein der Beteiligten, sondern fördert auch langfristige Motivation und Engagement.
4. Motivation hinterfragen:
Warum sollen marginalisierte Gruppen einbezogen werden? KARUNA betont, dass es wichtig ist, diese Frage aktiv zu reflektieren, damit Inklusion nicht nur ein Trend bleibt, der marginalisierte Gruppen ausnutzt, sondern tatsächlich allen Beteiligten zugutekommt:
„Es geht nicht darum, Diversität umzusetzen, weil es gerade trendy ist, sondern weil es einen echten Mehrwert für alle Beteiligten gibt.“
Rebecka warnt davor, einen oberflächlichen oder rein symbolischen Ansatz von Inklusion zu verfolgen:
„Es gibt die Gefahr von ‚Tokenism‘ – also Menschen nur als Repräsentant:innen einzuladen, ohne wirkliches Interesse an ihrer Perspektive."
Ein kontinuierlicher Lernprozess
Abschließend betont Rebecka, dass Inklusion ein Lernprozess ist, der Fehler erlaubt und Raum für Entwicklung lässt:
„Wir sind auch nicht perfekt und machen immer wieder Fehler. Aber wichtig ist, einfach anzufangen und dazuzulernen.“